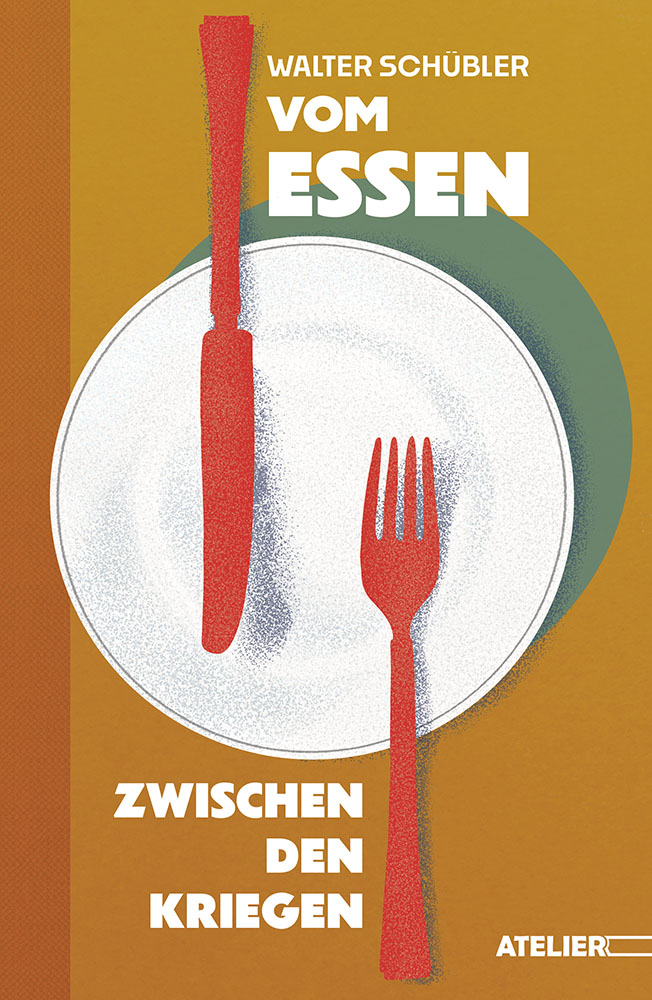Heute reisen wir in die VERGANGENHEIT.
Genau genommen in die Zwischenkriegszeit. Wie die 20 Jahre zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg kulinarisch verliefen, damit hat sich der Historiker Walter Schübler auseinandergesetzt. Sein Buch Vom Essen zwischen den Kriegen ist in der Edition Atelier herausgekommen.
Die Jahre zwischen 1918 und 1939 verlaufen kulinarisch zyklisch, stellt der Autor fest und belegt dies mit einer unglaublichen Fülle an Auszügen aus Zeitungen und Zeitschriften, Kochbüchern, aber auch mit Cartoons, Werbeplakaten und anderen Quellentexten. Alles über Essen und Trinken mitzunehmen war das erklärte Ziel. Von A wie „Abschöpffett“ bis Z wie „Zur sanierten Staatsoper“, dem Opernwirtshaus, dessen Speisekarte Karl Pollach 1932 in der lustigen Streitschrift „Der Götz von Berlichingen“ vorstellte. Da muss man sich nur noch entscheiden zwischen der Sieg-friedattensuppe und Romeo- und Juliensuppe, zwischen Dirig-Entenbraten mit Clemens Kraußbirnenkompott – anderswo habe ich dasselbe mit Zank-apfel-püree gesehen. Sehr spaßig. Ob der Dirigent Clemens Krauß ein Nationalsozialist war oder nicht, ist man sich nicht einig. Jedenfalls gingen seine Kontakte hinauf bis in die höchsten politischen Kreise, wurde er doch als Wagnerspezialist geschätzt, der Generaldirektor der Bayerischen Staatsoper. Andere Angebote aus dem Opernwirtshaus sind Nibe-lungenbraten mit Waldvögerlsalat, dann eine Lehmanndeltorte sowie ein Othellopudding. An Tischweinen wurden serviert Parsi-falerner, Brün-hildesheimer und Lohen-grinzinger, edle Tropfen, um die Gäste ganz auf Kunstgenuss einzustellen. Darüber konnte man damals wenigstens lachen.
Die Lesenden tauchen ein in ein Panoptikum breitgestreuter kulinarischer Vorstellungen, die auf 30 Schauplätze verteilt sind, gleich den Kapiteln. Ob das Überlegungen über den Blattsalat sind oder ein Eintopfgesicht, einer Anton Kuh’schen Verwexserungsgeschichte zum Eintopfsonntag 1938. Eine enorme Bandbreite an Materialien bilden die Ess- und Trinkkultur von Wien vor einhundert Jahren ab.
Dem Historiker Walter Schübler in irgendeiner Weise gerecht zu werden ist ein Ding der Unmöglichkeit, zu viele kulinarische Bestandsaufnahmen liegen hier vor. Alle spannend. Deshalb schlage ich das Buch an einigen Stellen willkürlich auf und beschreibe kurz, was der Autor zu erzählen hat.
Auf Seite 13 erfahren wir aus dem Argentinischen Tagblatt von einer gewissen Anita, dass grüner Salat am besten schmeckt, wenn er nicht schön aussieht. Denn, allzu schöner Salat ist nicht ‚durch’, hat nicht mit jeder Fiber Oel, Essig etc. eingesogen. Ausführlicher beschäftigt sich dann Karl Schnog mit der Salat-Zubereitung. Natürlich sollen das Sprößlinge aus allen fruchtbaren Gegenden unseres Vaterlandes sein, die, gereinigt und zerkleinert ohne aromaverderbende lange Sauce zu einem leicht verdaulichen Beigericht verarbeitet werden.
Einen ersten Eindruck von der kulinarischen Wirklichkeit im Jahre 1919 gibt ein anonymer Blick in die Kochtöpfe preis. Ort: ein Wiener Mietshaus mit vielen Parteien. Im Halbstock wohnt ein Kaufmann mit Frau, Kind, Dienstboten und Köchin, ein Kriegsgewinnler, der sich alles leisten kann. Die nächste Partei ist eine Beamtenfamilie mit zwei Kindern. Ihr Mittagessen besteht aus einer dünnen Wassersuppe mit ein wenig Grünzeug. Unterm Dach wohnt eine Wäscherin in den 70ern, ihr Sohn ist gefallen und sie muss sich um ihr vierjähriges Enkerl kümmern. Sie kann zu Hause nicht kochen, es langt die Kohle nicht. Das Essen holt sie aus der Volksküche. Eine Schale Kaffee und ein paar ‚Dalken‘, eine Masse aus Mehl und Wasser, die auf dem Ofen getrocknet und mit der bekannten Marmelade, die aus Rüben hergestellt ist, bestrichen wird, ist die Mahlzeit der Hausmeisterin.
Schauerlich sind diese Schilderungen von Not, vom Hunger.
Darf man wieder, gelegentlich einmal, vom Essen reden? Diese Frage stellt Karl Tschuppik und konstatiert, dass sich das Verhältnis des Wieners zum gedeckten Tisch geändert hat. Denn, die alten Geschichten vom Wiener Rindfleisch, die Erzählungen von den ‚Backhendln‘ und vom ‚Millirahmstrudel‘ klingen wie Märchen aus alter Zeit. Aber es gab Ausnahmen wie das sogenannte Leopoldstätter Sacher, das 1923 von einem braven Manne namens Schwarz geführt wurde. Ein fabelhafter Wirt, der das Wunder vollbrachte, Braten von Mastochsenfleisch und in wirklicher Butter, Mehlspeisen aus weißem Mehl, helles Brot und andere nie gesehene Dinge seinen Gästen anzubieten. Das kleine, aus zwei Zimmern bestehende Lokal, war mittags und abends stets belagert.
Eingestreut zwischen den Texten sind Abbildungen von Kochbüchern, wie das Buch der Kochkunst. Nur für Männer oder das Titelbild eines Frauenheftes, das zur Befreiung der Frau von der Küche aufruft. Auch Faksimiles von Rezepten einer Maismehlsuppe oder Falsche Polenta und andere, die auf der Rückseite von Tramway-Fahrscheinen abgedruckt waren. Noch mehr Rezepte finden sich auf dem hinteren Vorsatzpapier, während auf dem vorderen diverse Bezugskarten von Brot, Butter oder Zucker abgelichtet sind. Einfache Zeichnungen erhellen das Wirtshausleben während Cartoons, die mich an Loriotsche Comics erinnern, sich über das ewig gleiche Hotel-Menü mokieren, das in Kapstadt, Athen, Paris oder einer anderen Hauptstadt serviert wird.
Wie es um die tatsächliche Lebens- und Lebensmittelsituation im Jahre 1933 bestellt ist, erfährt man aus der berühmten Studie über die Arbeitslosen von Marienthal. Maria Lazarsfeld-Jahoda belegt darin protokollarisch die täglichen Mahlzeiten von 41 Familien, gibt so Auskunft über Speisezettel und Budget. Auffallend war der starke Mehlkonsum, so wurden über einen Zeitraum von 14 Tagen 5 1/2 kg verbraucht, während kaum Gemüse konsumiert wurde. Auffallend auch der regelmäßige und verhältnismäßig teure Milchverbrauch von 2 Litern täglich, der vornehmlich auf die Kinder entfällt. Das Stückchen Rindfleisch mit Knochen wird für den ersten Sonntag gekauft; die Rindsknochen wurden am zweiten Sonntag für die Suppe verwendet.
Ein Licht auf das Essverhalten werfen die Kochbücher jener Zeit und die Haushaltsrubriken in den Tageszeitungen.
Genaus so geht’s, genau so muss man’s machen! beginnt Schübler seine Glosse und nimmt sich die Zutatenlisten von Faschings-, Butter- und anderen -krapfen vor. Es geht um die Geborgenheit im Vertrauten, das Beharren auf immer Demselben oder wie Wittgenstein es ausdrückte: Ich esse alles, Hauptsache, es ist immer dasselbe. So sind auch Schüblers Glossen, jeweils am Ende eines Kapitel angesiedelt, kontrapunktisch und aufklärend, einfach tolle Ergänzungen.
Am 9. Mai 1924 sorgte Richard Strauss mit seinem Stück Schlagobers. Heiteres Wiener Ballett in zwei Aufzügen für große Empörung. Während auf der Bühne im ersten Akt eine Schlagobersorgie stattfindet mit Marzipanfiguren, Zwetschkenkrampussen und Lebkuchen, die aus ihren Dosen herausspringen, kriegerische Tänze aufführen und spukhaft wieder verschwinden, sind im zweiten gewöhnliche Volksmehlspeisen und Bäckereien die Hauptakteure. Salzstangerl, Brezel, Kipfel, Schmalznudeln, Baumkuchen, Gugelhupfe und Schaumrollen gehen in einer Revolte gegen das aristokratische k. u. k. Hofzuckerbäckerei-Gebäck auf die Straße. Der Ausgang ist versöhnlich, eben wienerisch. Aber damals war die Not der Wiener groß und sie nahmen es ihrem geliebten Strauss übel, dass er sich selbst ein dreieinhalb Milliarden Kronen teures Geburtstagsgeschenk inszenierte, was heute etwa einer Million Euro entspricht. Dem Leben mit und ohne Schlagobers widmet sich das ganze 5. Kapitel.
So unterschiedlich wie die Wiener Gesellschaft oder die dort Gestrandeten aus allen Weltkulturen, so unterschiedlich sind auch die Vorstellungen in dieser vom Niedergang der Monarchie geprägten Gesellschaft über Essen und Trinken. Da werden Kochschulen genauso aufs Korn genommen wie Gier und Überdruss oder Die Gesetze der Geselligkeit.
This is the end müsste das letzte, das dreißigste Kapitel überschriftet sein, denke ich. Aber nein, am Schluss geht es um die Kulinarische Gleichschaltung. Im Oktober 1933 feierte eine Institution den Tag des Eintopfs. Hitler machte daraus den Eintopfsonntag, kürte so ganz Deutschland zu einer einzigen großen Tischgemeinschaft. Der Autor Anton Kuh sah das etwas anders, spiegelbildlich und kreierte Das Eintopfgesicht. So kam zum Tropf der Topf oder, ein Reich, ein Kopf, ein Topf!
Was dann kommt ist viel Anhang, penibel recherchierte bibliographische Nachweise wie auch ein viele Seiten umfassendes kulinarisch-hauswirtschaftliches wie auch Personen- und Werkregister das so gut wie keinen Suchbegriff auslässt. Dementsprechend dicht ist der Informationsgehalt über das Essen zwischen den Kriegen. Vieles was uns heute in Sachen Kulinarik selbstverständlich ist, nahm seinen Anfang in der Zwischenkriegsepoche. Conveniece (Food), Superfood, Ideologisierung von Ernährungsstilen waren bereits vor einhundert Jahren en vogue.
Walter Schübler hat viel in den Archiven und Bibliotheken aufgestöbert und zwischen zwei Buchdeckel vereint. Vom Essen zwischen den Kriegen ist ein höchst amüsantes und informatives wie auch kurzweiliges Lesevergnügen. Allerdings sind manche der Schüblerschen Glossen so dicht an Inhaltlichem, fast zu überladen, dass es nicht immer leicht ist, den Lesefaden nicht zu verlieren. Bspw., wenn er die Mengenangaben verschiedener Krapfenrezepte ineinander verschachtelt, da wären weniger Zutatenauflistungen mehr Lesegenuss. Dennoch ist Vom Essen zwischen den Kriegen ein außerordentliches Werk, das anschaulich zu einem besseren Verständnis unserer Esskultur beiträgt.